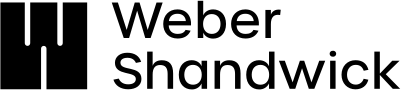Ansprechend, spannend und vor allem originell: Wer in der heutigen Zeit versucht, Neues zu schaffen, steht vor einem Problem. So kreisen die Gedanken von Filmemachern, Autoren, aber auch Agenturen stets um die Frage, wie sie etwas sagen können, das bisher noch nicht gesagt wurde. Aber: Ist das überhaupt noch möglich? Bleibt uns mit Blick auf Jahrhunderte voller Kunstgeschichte und Jahrzehnte voller Popkultur und Werbekampagnen noch die Chance, etwas Neues zu erzählen?
Zwischen Poststrukturalismus und Einflussangst
Während meines Studiums las ich den Aufsatz „Der Tod des Autors“ vom französischen Philosophen Roland Barthes. Der Aufsatz wirbelte – und wirbelt noch immer – mächtig Staub auf, da er den Autoren eines Textes beim Lesen für tot erklärt. Was entsteht, ist die Geburt des Lesers – und des Poststrukturalismus in der Literatur. Barthes wusste mit dieser Wortwahl dermaßen zu provozieren, dass man zu leicht vergisst, dass er hier eine Wandlung beschreibt: Der Leser wird beim Lesen der Schaffer des tieferen Sinnes des Werkes. Die Originalität liegt quasi bei ihm selbst.
Mit dem Begriff „The Anxiety of Influence“ entwickelt der amerikanische Literaturtheoretiker Harold Bloom diesen Gedanken noch weiter und formt den Schaffensprozess. Zuerst erkennt Bloom quasi jedem Autor die Möglichkeit ab, etwas Neues und wirklich Originelles von sich aus zu schaffen. Vielmehr bündeln sich in neuen Werken die bisherigen Pfade von gelesenen Werken, ihrer Interpretationen und der rezipierten Kultur. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass kein Werk mehr autonom sei. Jede Neuschaffung sei nur eine Reaktion auf das, was es bereits vorher gab.
Es bedeutet, dass kreative Köpfe etwas Neues schaffen, wenn sie das Bisherige neu interpretieren – ähnlich wie bei Barthes’ Theorie. Dafür muss die Einflussangst bekämpft und überwunden werden. Gelingt dies nicht, sprechen wir von einer Nachahmung oder einem missglückten Remake der vorherigen Kunst. Wenn es jedoch gelingt, sprechen wir von einem Pastiche.
Pastiche, Hommage und Satire als Formen der Intertextualität
Der Pastiche ist die bewusste Nachahmung und somit auch die Weiterentwicklung des vorherigen Stoffes. Wir sehen dies in Werken, die bekannte Popkulturreferenzen nutzen, um eine neue Geschichte zu erzählen. Steven Spielberg jüngster Film “Ready Player One” ist übersäht mit Referenzen an seine eigenen, aber auch andere Filme und Werke, wie etwa die von Stephen King. Im Idealfall ist diese dann sogar erfolgreicher oder beliebter als das Original.
Medienwechsel, wie etwa die Verfilmung eines Buches oder eines Comics, übersetzen dazu Textzeilen oder einzelne Strips in das neue Kunstwerk mit ein. Geschieht dies anerkennend und handlungstreibend erleben wir, was die Literatur eine Hommage nennt. Wird dies jedoch für einen humoristischen Effekt genutzt, der uns zum Lachen bringt, lachen wir über die Parodie oder die Satire. Die Wiedererkennung der intertextuellen Referenz auf große Popkultur weckt in uns Erinnerungen und Emotionen, aber auch Erwartungen und Vertrautheit. Zum Beispiel, wenn eine Film- oder Werbefigur ein bekanntes Werk zitiert oder der Originalcharakter einer früheren Erzählung in einer Neuauflage wieder in Erscheinung tritt. Als Goethe-Fan schätze ich beispielsweise den Spot der Berliner Verkehrsbetriebe, der „Willkommen und Abschied“ neu interpretierte. Allerdings kann man auch hier übertreiben und die Referenzen aus dem eigenen Handlungsuniversum überfrachten, wie es bei den neusten Filmen aus der Star Wars Saga der Fall ist. Wenn einzelne wiederkehrende Elemente aus der Originaltrilogie weder subtil noch handlungstreibend einsetzt werden, dienen sie vielmehr als eine Art Fan Service und ändern nichts an der Qualität des neuen Werkes.
Ist Neues zu schaffen nun unmöglich?
Ist es nun unmöglich, ganz auf Intertextualität zu verzichten? Nein. Allein die deutsche Sprache – geschrieben oder gesprochen – ist voll von Redewendungen, Symbolen oder Kontexten, die durch große Werke oder Bräuche geprägt worden sind. Letztlich ist auch genau das der Grund, warum Sprache überhaupt funktioniert.
Der Schlüssel, um dennoch originell zu erzählen, liegt in der Neuausrichtung der erzähltechnischen Tropen. Der Tropus beschreibt in der Rhetorik etwa Metaphern oder Allegorien. Beim Storytelling können dies jedoch Klischees von Handlungen und Figuren sein, wie etwa der Ritter in der schimmernden Rüstung, die Stadt als Dschungel, das Haus als Schutzstätte, der Wald als Wildnis. Werden diese Tropen geschickt gegeneinander ausgespielt und/oder entgegen ihrer verbundenen Erwartungshaltung neu interpretiert, entsteht eine gänzlich neue Handlung.
Es ist also nicht nötig, das Rad der originellen Erzählung neu zu erfinden. Das betrifft Autoren und Kreativkonzepter gleichermaßen. Ist man von der Einflussangst getrieben, muss diese zugelassen und kanalisiert werden. Nur so wird aus der „Anxiety of Influence“ letztlich auch die „The Power of Influence“.